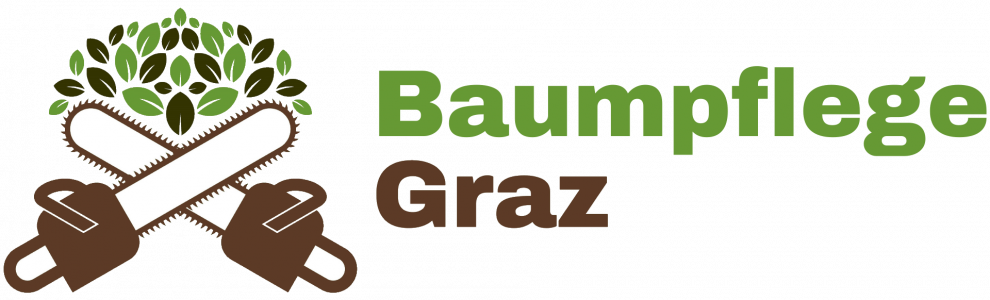Wer kennt es nicht? Man steht mit der Schere vor dem Obstbaum und weiß nicht so recht, wo man anfangen soll. Unsere Erfahrungen zeigen, dass viele Fehler beim Obstbaumschnitt in Privatgärten leider häufig gemacht werden. Dies führt nicht nur zu vermindertem Ertrag, sondern kann auch die Gesundheit des Baumes nachhaltig schädigen.
In den traditionellen Obstgärten der Steiermark, Niederösterreichs und des Burgenlands – Österreichs wichtigsten Obstanbauregionen – sieht man immer wieder die Folgen unsachgemäßen Obstbaumschnitts. Besonders in Zeiten, in denen immer mehr Österreicher ihren eigenen Garten bewirtschaften, ist fundiertes Wissen über den richtigen Obstbaumschnitt essenziell.
Wir von Baumpflege Graz arbeiten seit Jahren mit Obstbäumen und haben dabei die gleichen Fehler immer wieder gesehen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, welche Schnittfehler Sie unbedingt vermeiden sollten und wie Sie stattdessen vorgehen können. Denn ein richtig geschnittener Obstbaum dankt es Ihnen mit gesundem Wachstum und reicher Ernte!
Inhaltsverzeichnis
Toggle
1. Der falsche Zeitpunkt
Der Zeitpunkt des Obstbaumschnitts ist entscheidend für die Gesundheit und Vitalität des Baumes. In Österreich mit seinen spezifischen klimatischen Bedingungen gilt dies umso mehr. Die alpinen Regionen, das pannonische Klima im Osten und die milderen Bedingungen in Tallagen erfordern unterschiedliche Herangehensweisen.
Die idealen Schnittzeiten für österreichische Obstbaumarten
In Österreich hat sich für die meisten Obstbäume der späte Winter als idealer Zeitpunkt für den Hauptschnitt etabliert. Konkret bedeutet das für die verschiedenen Obstarten:
| Obstart | Optimaler Schnittzeitpunkt | Besonderheiten für Österreich |
|---|---|---|
| Apfel & Birne | Januar bis März | In höheren Lagen bis Anfang April möglich |
| Kirsche & Pflaume | August bis September | Sommerschnitt bevorzugt wegen Monilia-Gefahr |
| Pfirsich & Aprikose | Nach der Ernte bis September | In den wärmeren Lagen Österreichs (Wachau, Burgenland) |
| Marille | Unmittelbar nach der Ernte | Besonders wichtig für österreichische Marillengärten |
| Nuss | Juni/Juli | „Blutet“ bei Winterschnitt stark |
Der Winterschnitt fördert das Wachstum und ist ideal für junge Bäume, während der Sommerschnitt das Wachstum bremst und die Fruchtbildung fördert – besonders wichtig bei stark wachsenden Bäumen.
Klimatische Besonderheiten in Österreich beachten
In Österreich sollten Sie beim Zeitpunkt des Obstbaumschnitts unbedingt die regionalen klimatischen Unterschiede berücksichtigen:
- Alpenregionen: In höheren Lagen verzögert sich der optimale Schnittzeitpunkt oft bis Ende März oder sogar Anfang April
- Pannonisches Tiefland: In den wärmeren östlichen Landesteilen kann der Schnitt bereits ab Mitte Januar durchgeführt werden
- Südliche Bundesländer: In Kärnten und der Südsteiermark erlaubt das mildere Klima oft einen früheren Schnittbeginn
Absolut zu vermeiden ist der Obstbaumschnitt bei Temperaturen unter -5°C, da das Holz dann zu spröde wird und Risse entstehen können. Gerade in österreichischen Höhenlagen ein wichtiger Faktor!
Ein häufiger Fehler beim Obstbaumschnitt ist der Schnitt während der Hauptwachstumsphase im Frühling. Zu diesem Zeitpunkt verliert der Baum zu viel wertvolle Energie, die er für die Blüte und den Fruchtansatz benötigt.
2. Zu radikaler Rückschnitt
Einer der häufigsten Fehler beim Obstbaumschnitt ist die übereifrige Entfernung zu vieler Äste auf einmal. Dieser drastische Eingriff, oft euphemistisch als „Verjüngungsschnitt“ bezeichnet, kann schwerwiegende Folgen für den Baum haben.
Der „Beseneffekt“ – ein häufiges Problem in Obstgärten
Wenn zu viel Holz auf einmal entfernt wird, reagiert der Baum mit einem übermäßigen Austrieb, dem sogenannten „Beseneffekt“. In Österreich, wo besonders in der Steiermark und in Niederösterreich traditionelle Streuobstwiesen ein wichtiges Kulturgut darstellen, sieht man dieses Phänomen häufig bei älteren Bäumen.
Der Baum versucht, den massiven Verlust an Blattmasse zu kompensieren, indem er zahlreiche neue, meist steile Triebe bildet. Diese Wasserschosse (in Österreich regional auch „Räuber“ genannt) sind unproduktiv und verschlechtern die Kronenstruktur erheblich. Besonders bei alten Mostbirnensorten, die in der oberösterreichischen und niederösterreichischen Mostkultur eine wichtige Rolle spielen, führt dies zu einer Verschlechterung der Fruchtqualität.
Ein zu radikaler Schnitt zwingt den Baum, seine Überlebensstrategie zu aktivieren – dies geht immer zu Lasten der Fruchtbildung.
Erhöhte Krankheitsanfälligkeit durch Überschnitt
Regional unterschiedliche klimatische Bedingungen führen bei zu starkem Rückschnitt zu erhöhter Anfälligkeit für typische Obstbaumkrankheiten:
- Feuerbrand: Besonders in den bekannten Obstregionen Vorarlbergs und Tirols problematisch
- Monilia: In den feuchteren Regionen Österreichs ein großes Problem bei Steinobst
- Obstbaumkrebs: Tritt verstärkt nach übermäßigem Schnitt in allen österreichischen Anbauregionen auf
Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass zu stark geschnittene Bäume deutlich anfälliger für diese Krankheiten sind als fachgerecht beschnittene Exemplare.
Die 30%-Regel für österreichische Obstbäume
Als Faustregel gilt in der Obstbaumpflege: Nie mehr als 30% des Kronenvolumens auf einmal entfernen. Bei älteren, lange nicht geschnittenen Bäumen, wie sie oft auf traditionellen Streuobstwiesen im Mostviertel oder der Südoststeiermark zu finden sind, sollte der Verjüngungsschnitt über mehrere Jahre verteilt werden.
Anzeichen eines zu radikalen Rückschnitts an Ihrem österreichischen Obstbaum:
- Massiver Austrieb von Wasserschossen im Folgejahr
- Ausbleibender oder stark reduzierter Fruchtansatz
- Erhöhte Anfälligkeit für Sonnenbrand an freiliegenden Ästen (besonders im heißen pannonischen Klima des Burgenlandes ein Problem)
- Vorzeitiges Absterben einzelner Kronenteile in den Folgejahren
- Vermehrter Schädlingsbefall, insbesondere durch den Kleinen Fruchtwickler oder die Obstmade
Alte österreichische Sorten wie der ‚Maschanzker‘, die ‚Ilzer Rose‘ oder die ‚Österreichische Weinbirne‘ sind Teil unseres kulturellen Erbes und verdienen eine besonders achtsame Pflege.
3. Unsaubere Schnitte
Die Qualität der einzelnen Schnitte ist entscheidend für die Wundheilung und damit für die langfristige Gesundheit des Obstbaums. Unsaubere Schnitte stellen einen weiteren häufigen Fehler beim Obstbaumschnitt dar.
Wenn Schnittstellen ausgefranst sind oder Aststummel stehenbleiben, kann der Baum diese Wunden nur schwer verschließen. Dies führt zu längeren Heilungsprozessen und erhöht das Risiko für Pilzinfektionen und Fäulnis. Ein sauberer, glatter Schnitt hingegen ermöglicht dem Baum, die Wunde schneller mit Wundgewebe zu überwallen und abzuschließen.
Warum Schnittwunden richtig platziert sein müssen
Die richtige Platzierung von Schnittwunden ist ein entscheidender Faktor beim Obstbaumschnitt. Mit regional teilweise extremen Witterungsbedingungen – von feucht-milden Wintern im Bodenseeraum bis zu sehr kalten Perioden im Waldviertel – ist dies besonders wichtig für die Wundheilung.
Schnitte sollten immer so ausgeführt werden, dass:
- Das Regenwasser von der Wunde ablaufen kann
- Die Wundfläche möglichst klein ist
- Keine Stummel oder „Zapfen“ stehen bleiben
- Der Astring (die leichte Verdickung am Astansatz) erhalten bleibt
Bei den häufig auftretenden Spätfrösten in Tallagen und Mulden (besonders im Mühl- und Waldviertel) ist die korrekte Schnittführung noch wichtiger, da schlecht verheilte Wunden bei Frost aufplatzen können, was zu langfristigen Schäden führt.
Die Technik des „Astring-Schnitts“ und ihre Bedeutung
Der Astring-Schnitt ist die Basis jedes fachgerechten Obstbaumschnitts. Diese Technik, die an den Fachschulen für Obst- und Weinbau in Österreich gelehrt wird, respektiert die natürlichen Abwehrmechanismen des Baumes.
Der Astring ist eine leichte Verdickung an der Basis jedes Astes und enthält spezialisierte Zellen, die für den Wundverschluss verantwortlich sind. Schneidet man in diesen Astring hinein oder lässt man einen zu langen Stummel stehen, kann die Wunde nicht optimal verheilen.
Anleitung für einen korrekten Astring-Schnitt bei Obstbäumen
Um einen fachgerechten Astring-Schnitt durchzuführen, der eine optimale Wundheilung ermöglicht, befolgen Sie folgende Schritte:
- Identifizieren Sie den Astring an der Basis des zu entfernenden Astes
- Setzen Sie die Schere oder Säge knapp außerhalb des Astrings an
- Schneiden Sie parallel zur Stammachse (nicht senkrecht zum Ast)
- Achten Sie auf einen sauberen, glatten Schnitt ohne Ausrisse
Bei den in Österreich beliebten alten Streuobstsorten mit ihrer oft knorrigen Wuchsform erfordert dies besonderes Fingerspitzengefühl.
Typische Fehler wie Stummeln und Einrisse vermeiden
In den österreichischen Obstbauregionen vom Bodensee bis ins Burgenland werden immer wieder die gleichen Fehler beim Obstbaumschnitt beobachtet:
- Stummelbildung: Zu lange Aststummel trocknen ein und bieten Eintrittspforten für Pilze und holzzersetzende Organismen
- Einrisse: Entstehen durch falsches Absägen schwerer Äste – in Österreich ein häufiges Problem bei alten Mostobstbäumen
- Kragenschnitt: Zu nahes Schneiden am Stamm verletzt die Wundverschlusszellen
- Quetschungen: Entstehen durch stumpfes oder ungeeignetes Werkzeug
Bei dickeren Ästen, wie sie typischerweise bei traditionellen Hochstammsorten wie ‚Gravensteiner‘, ‚Kronprinz Rudolf‘ oder ‚Mostbirne‘ vorkommen, empfiehlt sich daher die spezielle Drei-Schnitt-Methode, um Rindenverletzungen und Ausrisse zu vermeiden:
- Einen Entlastungsschnitt ca. 30 cm vom Stamm von unten etwa zu einem Drittel einschneiden
- Den Ast knapp außerhalb dieses Schnitts komplett durchtrennen
- Den verbleibenden Stummel mit einem sauberen Astring-Schnitt entfernen
Das richtige Werkzeug für saubere Schnitte
Professionelle Obstbauern legen großen Wert auf qualitativ hochwertiges Schnittgerät, das den speziellen Anforderungen der heimischen Obstkultur entspricht:
| Werkzeug | Verwendung | Empfohlene Marke/Typ |
|---|---|---|
| Gartenschere | Äste bis 2,5 cm | Felco (Schweiz), Löwe (Deutschland) oder heimische Qualitätsprodukte |
| Astschere | Äste bis 5 cm | Zweihandscheren mit Übersetzung, z.B. von Fiskars oder WOLF-Garten |
| Baumsäge | Äste über 5 cm | Japansägen oder spezielle Astsägen mit Hohlschliff von Silky oder Bahco |
| Hochentaster | Für höhere Bereiche | Teleskopscheren mit Zugseil oder Teleskopsägen |
Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge regelmäßig desinfiziert werden – besonders in den österreichischen Feuerbrand-Befallsgebieten in Vorarlberg, Tirol und Salzburg ist dies essenziell, um eine Verbreitung von Krankheiten zu vermeiden.
4. Vernachlässigung von Wasserschossen
Wasserschosse sind ein alltägliches Phänomen in den Obstgärten – von den traditionellen Streuobstwiesen im Mostviertel über die modernen Intensivanlagen in der Steiermark bis hin zu den privaten Hausgärten im Wiener Umland. Die fachgerechte Behandlung dieser unerwünschten Triebe ist ein entscheidender Aspekt des Obstbaumschnitts, der oft vernachlässigt wird.
Was sind Wasserschosse und warum entstehen sie?
Wasserschosse (in manchen österreichischen Regionen auch als „Räuber“ bezeichnet) sind steil nach oben wachsende, meist sehr kräftige Triebe, die direkt aus dem Stamm oder aus stärkeren Ästen entspringen. Sie entstehen besonders unter den spezifischen Bedingungen, die in österreichischen Obstanbaugebieten häufig vorkommen:
- Nach zu starkem Rückschnitt (typisches Problem bei den robusten österreichischen Mostobstsorten)
- Bei Stress durch extreme Witterungsereignisse (zunehmend ein Problem durch den Klimawandel, der in Österreich besonders spürbar ist)
- Bei mangelnder Versorgung mit Nährstoffen (vor allem auf den kargen Böden in Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands)
- Nach Krankheitsbefall, etwa durch den in Österreich verbreiteten Feuerbrand oder Obstbaumkrebs
Wichtig zu wissen: Wasserschosse haben ein gestörtes Hormonsystem und entwickeln in der Regel kein oder nur minderwertiges Fruchtholz. Sie entziehen dem Baum wertvolle Energie und führen zu einer unerwünschten Beschattung der Krone.
Warum Wasserschosse regelmäßig entfernt werden müssen
Die konsequente Entfernung von Wasserschossen ist aus mehreren Gründen besonders für Obstbäume wichtig:
-
Verbesserung des Mikroklimas in der Krone: In den feuchteren Regionen Österreichs, etwa im Alpenvorland, ist eine gute Durchlüftung entscheidend zur Vermeidung von Pilzkrankheiten
-
Lenkung der Nährstoffversorgung: Die kurzen, intensiven Vegetationsperioden in den höheren Lagen Österreichs erfordern eine effiziente Nutzung der verfügbaren Nährstoffe
-
Erhalt der Kronenform: Besonders bei den traditionellen Hochstammsorten im österreichischen Streuobstbau sind klare Kronenstrukturen wichtig für die Baumpflege und Ernte
-
Vermeidung von Schattenwirkung: In den nördlicheren Lagen Österreichs mit weniger intensiver Sonneneinstrahlung ist die Lichtversorgung aller Kronenteile besonders wichtig
Die systematische Entfernung von Wasserschossen erfolgt idealerweise zweimal jährlich: einmal im Rahmen des Winterschnitts und ein zweites Mal im Sommer (Juni/Juli), wenn die Schossen noch weich und leicht zu entfernen sind.
Die richtige Technik zum Entfernen von Wasserschossen
Für die in Österreich verbreiteten Obstbaumarten – von Äpfeln und Birnen bis zu den für das Land typischen Marillen (Aprikosen) und Zwetschken – gelten folgende Prinzipien beim Entfernen von Wasserschossen:
Entfernung im Winterschnitt:
- Komplettes Entfernen bis auf den Astring
- Keine Stummel stehen lassen, da diese im nächsten Jahr mehrere neue Wasserschosse bilden können
Entfernung im Sommer (besonders effektiv):
- Am besten bei trockenem, sonnigem Wetter durchführen
- Junge Wasserschosse können mit der Hand „abgerissen“ werden
- Dabei den Trieb nach unten wegziehen, um die schlafenden Augen an der Basis mit zu entfernen
Diese Technik, die an der renommierten Gartenbauschule Schönbrunn in Wien gelehrt wird, verhindert besonders effektiv den Neuaustrieb.
Sonderfall bei Marillen: Bei den in Österreich wirtschaftlich bedeutenden Marillen (besonders in der Wachau) sollten Wasserschosse besonders konsequent entfernt werden, da diese Baumart anfällig für Gummifluss und Monilia ist – beides Probleme, die durch schlechte Belüftung verstärkt werden.
5. Fehlerhafte Ausdünnung der Krone
Ein klassischer Fehler beim Obstbaumschnitt ist die unzureichende Ausdünnung der Krone, wodurch Licht und Luft fehlen. Dieser Fehler führt zu einer dichten, schlecht belüfteten Krone, in der Pilzkrankheiten ideale Bedingungen finden und Früchte im Inneren wegen Lichtmangels klein und farblos bleiben.
Besonders in feuchteren Regionen Österreichs kann dies schnell zu Schorfbefall und anderen Krankheiten führen, während die Fruchtqualität deutlich leidet. Eine gut ausgelichtete Krone hingegen fördert gleichmäßiges Wachstum und optimale Fruchtentwicklung.
Die Bedeutung von ausreichender Belichtung innerhalb der Krone
Die optimale Ausnutzung des verfügbaren Lichts ist essenziell für eine gute Fruchtqualität, besonders in Regionen mit unterschiedlichen Sonnenverhältnissen. Während die nördlichen Bundesländer und höhere Lagen oft mit geringerer Sonneneinstrahlung auskommen müssen, profitieren südliche und östliche Landesteile von intensiverem Licht.
Ein falsch ausgedünnter Baum zeigt typische Symptome:
- Früchte reifen ungleichmäßig
- Früchte im Inneren der Krone bleiben klein und farblos
- Erhöhte Anfälligkeit für Pilzkrankheiten (ein besonderes Problem in den feuchteren westlichen Landesteilen Österreichs)
- Verminderte Blütenknospenbildung im Folgejahr
Wie Sie konkurrierende Äste richtig identifizieren und entfernen
Bei der Kronenausdünnung im Rahmen des Obstbaumschnitts sollten Sie besonders auf folgende problematische Strukturen achten, die in heimischen Obstgärten häufig vorkommen:
- Reibeäste: Äste, die sich gegenseitig berühren und scheuern, wodurch Verletzungen entstehen
- Paralleläste: Äste, die in gleicher Richtung und mit ähnlichem Abstand wachsen
- V-förmige, spitze Astgabeln: Besonders problematisch bei den in Österreich traditionellen Hochstammsorten, da sie später auseinanderbrechen können
- Ins Kroneninnere wachsende Äste: Beschatten das Innere und verschlechtern die Luftzirkulation
- Überkreuzende Äste: Führen zu Verwirrung in der Kronenstruktur und gegenseitiger Beschattung
Besonders für die in Österreich verbreiteten alten Mostsorten, die häufig zu dichtem Wuchs neigen, ist eine konsequente Entfernung von Konkurrenzästen wichtig. Die Landwirtschaftskammer Oberösterreich empfiehlt für diese traditionellen Sorten im Mostviertel und Innviertel die sogenannte „Öschbergschnitt-Methode“, die eine klare Kronenstruktur mit 3-4 Leitästen fördert.
Prioritäten beim Ausdünnen der Obstbäume
Die Reihenfolge der Schnittmaßnahmen sollte bei der Kronenausdünnung wie folgt sein:
- Kranke und tote Äste vollständig entfernen
- Stark nach innen wachsende Äste entfernen
- Von stärkeren konkurrierenden Ästen den ungünstiger platzierten entfernen
- Steil nach oben wachsende Triebe entfernen oder umleiten
- Sich kreuzende oder reibende Äste ausdünnen
Praktischer Tipp für österreichische Verhältnisse: In Regionen mit häufigen Schneefällen, wie etwa im Mühlviertel oder in Teilen Kärntens, sollten Sie besonders auf eine stabile Astanbindung achten und V-förmige Verzweigungen konsequent vermeiden.
Warum eine gute Kronenstruktur die Basis für gesundes Wachstum ist
Eine gut strukturierte Krone wirkt sich positiv auf zahlreiche Aspekte der Baumgesundheit aus und ist besonders unter den spezifischen Bedingungen des österreichischen Klimas wichtig:
-
Krankheitsprävention: Besonders wichtig in den feuchteren Regionen Österreichs, wo Pilzkrankheiten wie Schorf und Monilia häufiger auftreten
-
Frostschutz: In den österreichischen Obstbaugebieten mit Spätfrostgefahr (z.B. Südtiroler Unterland, Teile des Mostviertels) sorgt eine gute Luftzirkulation für einen besseren Temperaturausgleich
-
Bessere Fruchtqualität: Für die hochwertigen österreichischen Tafelobstsorten entscheidend für Farbe, Größe und Aromatik
-
Erleichterte Pflege: Verbesserte Zugänglichkeit für Schnitt, Ausdünnung und Ernte – besonders wichtig bei den traditionellen Hochstämmen in österreichischen Streuobstwiesen
-
Verlängerte Erntephase: Gleichmäßigere Abreifung, was besonders bei den österreichischen Direktvermarktern und Selbstpflückgärten geschätzt wird
Eine gute Kronenstruktur ist wie ein gut durchdachtes Haus – sie bietet optimale Bedingungen für alle Bewohner und widersteht den Herausforderungen der Zeit.
6. Ignorieren der Baumform
Die richtige Formgebung beim Obstbaumschnitt ist eine Kunst, die in Österreich eine besonders lange Tradition hat. Von den historischen Spaliergärten in Schönbrunn bis zu den modernen Intensivanlagen in der Steiermark – die richtige Baumform ist entscheidend für Ertrag und Pflegeaufwand. Leider wird dieser Aspekt beim Obstbaumschnitt in privaten Gärten oft vernachlässigt.
Häufige Fehler beim Obstbaumschnitt zeigen sich besonders bei jungen Bäumen, wo fehlender Pflanzschnitt und mangelnde Formgebung in den ersten Jahren langfristige negative Folgen haben. Viele Hobbygärtner unterschätzen, wie wichtig gerade die ersten Schnitteingriffe für die spätere Entwicklung sind.
Ohne fachgerechten Pflanzschnitt bilden sich schwache Kronen mit ungünstigen Astanbindungen, die später brechen können. Die Vernachlässigung der frühen Formgebung lässt sich in späteren Jahren oft nur mit großem Aufwand korrigieren und führt zu instabilen Bäumen mit reduziertem Ertragspotenzial.
Verschiedene Erziehungsformen und ihre Vor- und Nachteile in Österreich
Es haben sich je nach Region und Verwendungszweck unterschiedliche Erziehungsformen etabliert. Diese sind an die klimatischen und kulturellen Besonderheiten des Landes angepasst:
| Erziehungsform | Typische Verwendung in Österreich | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|---|
| Hochstamm | Streuobstwiesen im Mostviertel, Traditioneller Obstbau | Langlebig, landschaftsprägend, Unternutzung möglich | Schwierige Pflege, später Ertragseintritt |
| Halbstamm | Hausgärten in ganz Österreich, Kleinere Erwerbsanlagen | Guter Kompromiss aus Ertrag und Standfestigkeit | Mittlerer Pflegeaufwand, benötigt mehr Platz als Niederstamm |
| Spindel | Moderne Erwerbsanlagen in der Steiermark und Tirol | Früher Ertrag, platzsparend, leichte Pflege | Kürzere Lebensdauer, anfälliger für Trockenheit |
| Palmette | Historische Gärten (Schönbrunn), Hausgärten mit begrenztem Platz | Dekorativ, platzsparend, gute Fruchtqualität | Hoher Pflegeaufwand, intensive Formierung nötig |
| Öschberg-Krone | Traditionelle Obstgärten in Westösterreich | Robuste Form, gute Belichtung, stabil | Benötigt regelmäßigen Schnitt, sonst Verkahlung |
Die vielfältigen klimatischen und topografischen Bedingungen in den österreichischen Bundesländern haben zur Entwicklung regionaler Schnitt- und Erziehungsformen geführt:
- Im Burgenland haben sich wegen der häufigen Trockenphasen eher kompaktere Formen wie die modifizierte Spindel durchgesetzt
- In den alpinen Regionen Tirols und Salzburgs werden wegen der Schneelast stabilere Kronenformen mit flacheren Astabgangswinkeln bevorzugt
- In der Steiermark als größtem Obstanbaugebiet Österreichs dominieren heute schlanke Spindelbäume in Dichtpflanzung
- Im Mostviertel werden traditionell Hochstämme für die Mostobstproduktion favorisiert
Wie man die natürliche Wuchsform des Baumes respektiert und lenkt
Jede Obstbaumart und -sorte hat eine charakteristische natürliche Wuchsform, die beim Obstbaumschnitt berücksichtigt werden sollte. Dies gilt besonders für die traditionellen Sorten, die oft markante Wuchseigenschaften aufweisen:
- Steil aufrecht: Typisch für viele österreichische Mostbirnensorten wie ‚Speckbirne‘ oder ‚Pichlbirne‘
- Breit ausladend: Charakteristisch für alte Apfelsorten wie ‚Steirischer Maschanzker‘ oder ‚Ilzer Rose‘
- Hängend: Häufig bei Sorten wie ‚Grafensteiner‘ oder manchen Zwetschkensorten
- Kompakt: Moderne österreichische Züchtungen wie ‚Gala‘ oder ‚Topaz‘
Der richtige Obstbaumschnitt unterstützt diese natürlichen Tendenzen, statt gegen sie zu arbeiten. Beispiel: Bei einer von Natur aus breit wachsenden Sorte wie dem ‚Steirischen Maschanzker‘ sollte man nicht versuchen, eine schmale Spindelform zu erzwingen.
Häufige Formgebungsfehler bei jungen Bäumen und deren langfristige Auswirkungen
Gerade bei der Erziehung junger Obstbäume werden in Privatgärten oft grundlegende Fehler gemacht, die langfristige negative Folgen haben können:
-
Fehlender Pflanzschnitt: In Österreich werden oft Jungbäume ohne den wichtigen Pflanzschnitt gesetzt, was zu schwachem Austrieb und schlechter Kronenbildung führt
-
Zu hohe Stammbildung: Besonders in alpinen Regionen problematisch, da hohe Stämme anfälliger für Frostschäden und Sonnenbrand sind
-
Konkurrenztriebekrone: Wird der Mitteltrieb nicht klar dominierend erzogen, entstehen instabile V-förmige Kronen, die unter österreichischer Schneelast oft brechen
-
Falscher Pflanzabstand: In vielen österreichischen Hausgärten werden Obstbäume zu dicht gepflanzt, was später zu Lichtmangel und gegenseitiger Behinderung führt
-
Vernachlässigung der Erziehungsphase: Die ersten 3-5 Jahre sind entscheidend für die spätere Form, werden aber oft in der Pflege vernachlässigt
Besonders gravierend sind diese Fehler bei den traditionellen österreichischen Sorten, die oft spezifische Ansprüche an die Formgebung stellen. So sollten beispielsweise die starkwüchsigen alten Mostbirnensorten aus dem Mostviertel von Anfang an konsequent ausgelichtet werden, während man bei den kompakteren modernen Sorten vorsichtiger vorgehen sollte.
Korrekturmaßnahmen für falsch erzogene Bäume in österreichischen Obstgärten
Auch für bereits falsch erzogene Bäume gibt es Hoffnung. Die österreichische Obstbauberatung hat verschiedene Korrekturmaßnahmen entwickelt, die an die spezifischen Bedingungen im Land angepasst sind:
-
Für zu dichte Kronen (häufig in feuchteren westlichen Bundesländern):
- Konsequente Auslichtung über mehrere Jahre verteilt
- Beginn mit dem Entfernen kreuzender und nach innen wachsender Äste
- In Vorarlberg und Tirol besonders wichtig wegen höherer Luftfeuchtigkeit
-
Für konkurrierende Leittriebe (typisches Problem in Hausgärten):
- Entscheidung für den besser positionierten Leittrieb
- Schrittweise Zurücknahme des Konkurrenten über 2-3 Jahre
- Beachten der lokalen Windverhältnisse (besonders im Burgenland relevant)
-
Für zu hoch gewachsene Bäume (oft in älteren Streuobstbeständen):
- Absenkung der Krone durch gezielten Rückschnitt auf tiefer stehende Seitenäste
- In mehrjährigen Schritten, um Sonnenbrand zu vermeiden (besonders wichtig im sonnigen Osten Österreichs)
- Eventuell Weißeln des Stammes zum Sonnenschutz
-
Für vernachlässigte Formobstbäume (in historischen österreichischen Gärten):
- Behutsame Wiederherstellung der Grundstruktur
- Erhaltungsschnitt mit Fokus auf die Hauptäste
- Oft in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesdenkmalamt
Bei der Korrektur falsch erzogener Bäume ist Geduld das oberste Gebot. Verteilen Sie die notwendigen Schnittmaßnahmen über mehrere Jahre und beobachten Sie genau die Reaktion des Baumes auf Ihre Eingriffe.
7. Fehlende Nachsorge
Der Obstbaumschnitt selbst ist nur ein Teil der Gesamtpflege. Viele Hobbygärtner vernachlässigen die wichtige Nachsorge, die für den langfristigen Erfolg der Schnittmaßnahmen entscheidend ist.
Gerade unter den spezifischen klimatischen Bedingungen ist die richtige Nachsorge ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die mangelnde Nachsorge ist ein oft übersehener Fehler beim Obstbaumschnitt, der den Erfolg aller vorherigen Bemühungen gefährden kann.
Warum die Pflege nach dem Schnitt genauso wichtig ist wie der Schnitt selbst
Der fachgerechte Obstbaumschnitt ist nur der erste Schritt – die anschließende Pflege entscheidet maßgeblich über die Gesundheit und Produktivität der Bäume und muss an die jeweiligen klimatischen Bedingungen angepasst werden:
-
Wundverschluss und -schutz: Besonders wichtig in Regionen mit hohen Niederschlägen wie Vorarlberg oder dem Salzkammergut
-
Düngung und Bewässerung: Kritisch in den trockenen Regionen Ostösterreichs und des Burgenlandes
-
Monitoring auf Krankheiten und Schädlinge: In allen Regionen wichtig, aber besonders in den Befallsgebieten von Feuerbrand (Vorarlberg, Tirol, Salzburg) und Apfelwickler (Steiermark)
-
Kontrolle des Neuaustriebs: Besonders wichtig bei den starkwüchsigen traditionellen österreichischen Sorten
Wann Wundverschlussmittel sinnvoll sind und wann nicht
Die Frage nach der Verwendung von Wundverschlussmitteln wird unter Obstbauern und Hobbygärtnern kontrovers diskutiert. Die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse geben folgende Richtlinien:
Wundverschlussmittel können in bestimmten Fällen sinnvoll sein:
- Bei spezifischen Pilzinfektionen wie Obstbaumkrebs, wo gezielte Schutzmittel hilfreich sein können
- Bei Steinobst, insbesondere während feuchter Perioden
- Bei sehr empfindlichen Arten und Sorten in besonderen Stresssituationen
- Bei Veredlungsstellen, um das Austrocknen zu verhindern
In den meisten Fällen ist es besser, auf Wundverschlussmittel zu verzichten:
- Bei kleinen bis mittelgroßen Schnittwunden (unter 5 cm)
- Bei gesunden Bäumen mit guter natürlicher Abschottungsfähigkeit
- Bei Schnittmaßnahmen während der Winterruhe
- Bei modernen Sorten, die gezielt auf gute Wundheilung selektiert wurden
- Im biologischen Anbau, wo saubere Schnitte und die natürliche Abschottung bevorzugt werden
Wichtiger als Wundverschlussmittel sind saubere, glatte Schnitte am richtigen Ort und zur optimalen Zeit.
Richtige Entsorgung des Schnittguts zur Vermeidung von Krankheiten
Die sachgerechte Entsorgung des Schnittguts ist in Österreich aus mehreren Gründen besonders wichtig:
-
Verhinderung der Ausbreitung von Krankheiten: Besonders in den offiziellen Feuerbrand-Befallsgebieten Österreichs ist dies gesetzlich geregelt
-
Vermeidung von Infektionsquellen: Wichtig für die bedeutenden Erwerbsobstbauregionen in der Steiermark und in Tirol
-
Einhaltung lokaler Vorschriften: In vielen österreichischen Gemeinden gelten spezifische Regelungen zur Entsorgung von Gartenabfällen
Die unsachgemäße Entsorgung von befallenem Schnittgut ist in den österreichischen Kernobstanbaugebieten eine der Hauptursachen für die Verbreitung von Obstbaumkrankheiten. Besonders bei Feuerbrand kann dies existenzbedrohend für Erwerbsobstbauern sein.
Überwachung des Baumes nach dem Schnitt – worauf Sie achten sollten
In den Wochen und Monaten nach dem Obstbaumschnitt sollten Sie Ihren Baum regelmäßig beobachten, um Probleme frühzeitig zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Unter österreichischen Bedingungen sind folgende Aspekte besonders wichtig:
-
Wundheilung überwachen:
- Kontrollieren Sie große Schnittwunden auf Anzeichen von Fäulnis oder stockender Heilung
- In niederschlagsreichen Regionen wie Vorarlberg oder dem Salzkammergut häufiger kontrollieren
-
Neuaustrieb beobachten:
- Bei den in Österreich typischen Frühjahrs-Wetterkapriolen (späte Fröste) kann der Neuaustrieb geschädigt werden
- Übermäßigen Neuaustrieb von Wasserschossen etwa 4-6 Wochen nach dem Schnitt entfernen
-
Auf Schädlinge und Krankheiten achten:
- Frische Schnittwunden können Eintrittspforten für Schaderreger sein
- In Österreich besonders relevante Schädlinge nach dem Schnitt: Borkenkäfer, Apfelwickler, Glasflügler
-
Nährstoff- und Wasserversorgung sicherstellen:
- Nach starkem Rückschnitt sollte der Baum ausreichend mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden
- Besonders in den trockenen Regionen des Burgenlandes und Niederösterreichs wichtig
-
Statik und Stabilität prüfen:
- Nach stärkeren Schnitten kann sich die Statik des Baumes verändern
- Besonders in den schneereichen Regionen Österreichs wichtig für die Winterstabilität
Fazit
Der richtige Obstbaumschnitt ist eine Kunst, die unter vielfältigen klimatischen Bedingungen sorgfältiges Vorgehen erfordert. Die sieben häufigsten Fehler beim Obstbaumschnitt – falscher Zeitpunkt, zu radikaler Rückschnitt, unsaubere Schnitte, Vernachlässigung von Wasserschossen, fehlerhafte Kronenausdünnung, Ignorieren der Baumform und mangelnde Nachsorge – können durch fundiertes Wissen vermieden werden.
Die richtige Balance zwischen Erhaltung und Erneuerung bildet den Kern eines erfolgreichen Schnitts. In alpinen Regionen liegt der Fokus auf Stabilität, während Obstbäume in pannonischen Klimazonen mehr Aufmerksamkeit bei der Feuchtigkeitsversorgung benötigen. Traditionelle Sorten verlangen dabei oft andere Schnittansätze als moderne Züchtungen – ein Wissen, das über Generationen weitergegeben wurde.
Wer typische Fehler beim Obstbaumschnitt vermeiden möchte, sollte lokales Expertenwissen nutzen. Landwirtschaftskammern und regionale Obstbauverbände bieten wertvolle, standortangepasste Empfehlungen. Mit Geduld und regelmäßiger Pflege werden Obstbäume zu langlebigen, ertragreichen Begleitern, die nicht nur köstliche Früchte liefern, sondern auch zur Biodiversität beitragen.